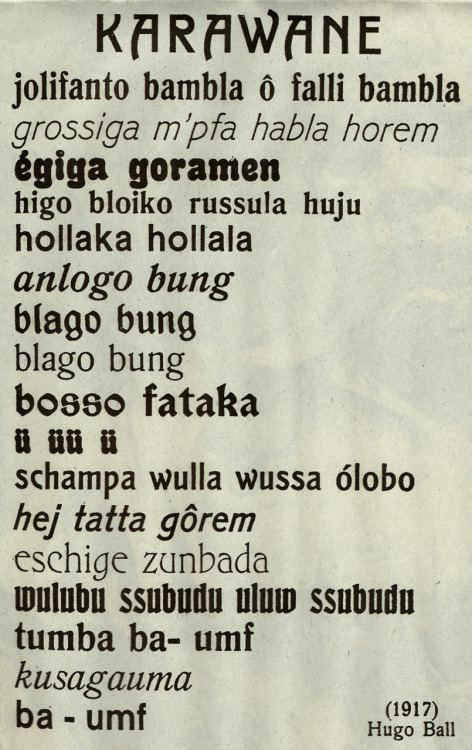Ein Gastbeitrag von Dieter Hoffmann (rotherbaron)
Kindheit und Schule in der Dichtung Jacques Préverts

Bei einem Blick auf die Biographie des am 4. Februar 1900 in Neuilly-sur-Seine geborenen und am 11. April 1977 in Omonville-la-Petite verstorbenen Jacques Prévert wäre manch einer wohl geneigt zu sagen, dass diesem Autor das Dichten nicht gerade in die Wiege gelegt worden ist. Sein Vater musste sich lange mit Gelegenheitsarbeiten durchschlagen, ehe er schließlich in Paris eine Anstellung bei einer Wohltätigkeitsorganisation fand. Sein Sohn geriet im Dschungel der Großstadt ins Kleinkriminellenmilieu, so dass Prévert sich später selbst über die „Jungfräulichkeit“ seines Strafregisters wunderte (1). Der Schulunterricht war bei alledem nichts weiter als ein lästiges Übel, und das Schwänzen des Unterrichts mündete folgerichtig in das frühestmögliche Verlassen der Schule (mit 15 Jahren).
Hätte man Prévert gefragt, wie er mit dieser geringen Schulbildung Dichter hatte werden können, so wäre die Antwort wohl gewesen, dass dies nicht trotz, sondern wegen seiner Distanz zum Schulbetrieb geschehen sei. So hat er sich etwa gegen die Standardisierung des geistigen Fortschritts gewandt, die das gleichschrittige Lernen in der Schule mit sich bringe. Wenn man sage, dass ein Kind in der Schule keine Fortschritte mache, würden dabei oft die anderen, von den schulischen Tests nicht gemessenen und womöglich auch gar nicht mit dem Unterricht zusammenhängenden Entwicklungen übersehen, die ein Kind durchlaufe:
„Un enfant, (…) à l’école, on dit: il ne fait pas de progrès. Pourtant, on ne sait pas, on ne peut pas savoir s’il n’en fait pas, dans une direction différente“ (2).
Mit Montaigne kritisiert Prévert daher die „Gefangennahme“ des kindlichen Geistes in der Schule, wo dieser den Launen eines missmutigen Lehrers ausgeliefert sei und so seiner individuellen Kraft beraubt werde (3).
Drei der bekanntesten Gedichte Préverts sind dieser Thematik gewidmet. In Le cancre (‚Der Schulversager‘; 4) rebelliert ein Schüler gegen die geistige Unterdrückung durch den Lehrer, indem er all die abstrakten Zahlen und Fakten, die er lernen soll, wegwischt und sie mit dem „Gesicht des Glücks“ übermalt. Analog dazu werden die Voraussetzungen geistiger Freiheit in Page d’écriture (‚Rechenübung‘; 5) gerade dadurch geschaffen, dass die Schüler sich von den mathematischen Repetierübungen des Lehrers ab- und dem Vogel der Phantasie zuwenden, der mit seinem Gesang die Mauern des Klassenzimmers und damit die Schulwirklichkeit in sich zusammenstürzen lässt:
„Und die Glasscheiben werden wieder zu Sand, / die Tinte wird wieder zu Wasser, / die Pulte werden wieder zu Bäumen, / die Kreide wird zu einem Kreidefelsen / und der Federhalter zu einem Vogel“ (6).
In Chasse à l’enfant (‚Jagd auf das Kind‘; 7) schließlich wird ein aus einer Erziehungsanstalt ausgebrochenes Kind wie ein „gehetztes Tier“ von der „Meute der anständigen Leute“ gejagt, die seine Flucht in die Freiheit als Anschlag auf die soziale Ordnung empfinden und entsprechend zu ahnden versuchen. Indem dabei nicht von „einem“, sondern „dem“ Kind die Rede ist, erscheint dieses allgemein als Symbol für die im Alltag der bürgerlichen Gesellschaft unterdrückte geistige Freiheit.
Der Sinn der Schule (und des Verständnisses von Erziehung und Bildung, für die sie steht) ist es damit nach Prévert nicht in erster Linie, den Kindern wichtige geistige Inhalte und Fertigkeiten beizubringen. Ihren hauptsächlichen Zweck sieht er vielmehr darin, den Kindern ihre geistige Unabhängigkeit auszutreiben. Diese exemplifiziert er an dem speziellen Blick von Kindern, der die Maskerade des sozialen Alltags durchdringe und so bei den Erwachsenen Peinlichkeitsgefühle hervorrufe:
„Häufig habe ich Leute zu ihrem Kind sagen hören: ‚Senk die Augen!‘ Denn der Blick von Kindern erzeugt bei den Erwachsenen fast immer Scham“ (8).
Er selbst, so Prévert, habe sich deshalb eben diesen Kinderblick – und mit ihm die „Tränen“, das „Lachen“ und die „glücklichen Geheimnisse“ der Kindheit – zu bewahren versucht. Und so stelle er „zu meinem Vergnügen“ noch immer kindliche Fragen – also Fragen, die durch ihre Distanz zum Alltagsgeschehen zu Verfremdungseffekten führen und so einen neuen Blick auf dieses ermöglichen (9).
Zitatenachweis:
(1) Prévert, Jacques / Pozner, André: Hebdromadaires (1972), S. 85. Paris 1982: Éditions Gallimard.
(2) Ebd., S. 101.
(3) Ebd., S. 101 f.
(4) Prévert, Jacques: Paroles (1946), S. 63. Paris 1949: Éditions Gallimard.
(5) Ebd., S. 146 f.
(6) Ebd., S. 147.
(7) Ebd., S. 86 f.
(8, 9) Prévert, Jacques / Pozner, André: Hebdromadaires (1972), S. 62. Paris 1982: Éditions Gallimard.
Freie Nachdichtungen:
Rechenstunde
(nach Page d’écriture)
Zwei und zwei sind vier
plus vier sind acht
was mal zwei dasselbe macht
minus vier sind’s wieder vier
Rechenkette eng gefügt
um die Zahlen um die Köpfe
auf akkuraten Karos
eine zitternde Feder
eine Vogelfeder vor dem Fenster
gleitet vorbei
gleitet in die Herzen hinein
ein unberechenbares Lied
löst die eng gefügte Kette
um die Zahlen um die Köpfe
zu unzähligen Gliedern
einem Meer aus bunten Wissensmurmeln
unkalkulierbar glitzernd
befreit
taucht die Feder hinein.
Der Klassenclown
(nach Le cancre)
Unter ihm
die gescheitelten Köpfe
der Musterschüler,
vor ihm
der lauernde Blick
des Lehrers.
Die Salven der Fragen
prasseln auf ihn ein,
er taumelt
im Kugelhagel der Probleme,
die nicht die seinen sind.
Plötzlich aber
lacht sich der helle Wahnsinn
durch sein verdüstertes Gesicht.
Er greift nach dem Schwamm
und wischt es einfach weg,
das Labyrinth aus Zahlen und Fakten,
aus Daten und Begriffen,
aus Phrasen und Formeln,
und übermalt
unter dem Gejohle der Klassenmanege
regenbogenfarben
die dunkle Tafel des Unglücks
mit dem strahlenden Gesicht des Glücks.



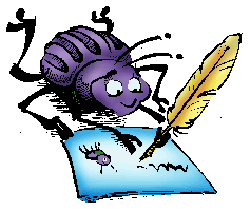 PD über „Begabung“ in Mainz. Ich muss an Florian denken, den kleinen Käferspezialisten, den ich einmal an einer Grundschule unterrichtet habe. Käfer waren Florians ganze Leidenschaft. Wann immer seine Eltern ihm etwas Gutes tun wollten, zerrte er sie in eine Buchhandlung und suchte sich dort ein Buch über Käfer aus.
PD über „Begabung“ in Mainz. Ich muss an Florian denken, den kleinen Käferspezialisten, den ich einmal an einer Grundschule unterrichtet habe. Käfer waren Florians ganze Leidenschaft. Wann immer seine Eltern ihm etwas Gutes tun wollten, zerrte er sie in eine Buchhandlung und suchte sich dort ein Buch über Käfer aus.